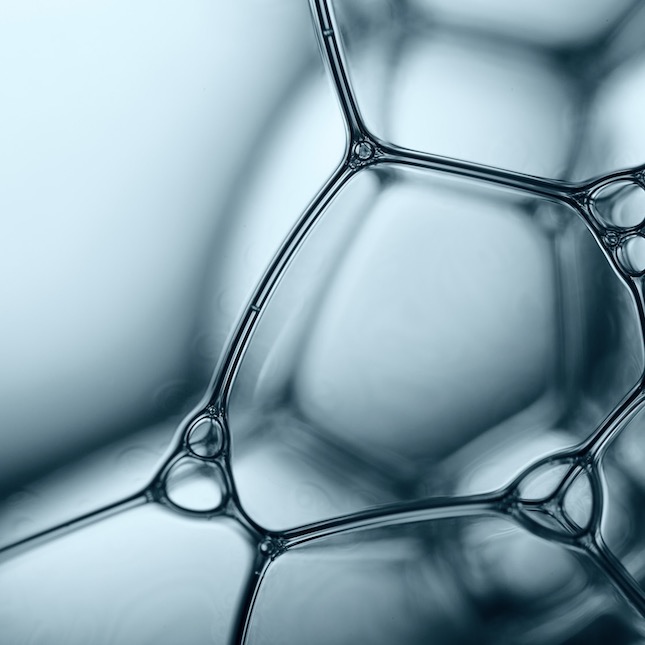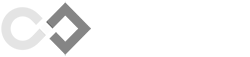Das Konzept der transformativen Resilienz ermöglicht es, Resilienzpolitik an expliziten positiven Gestaltungszielen auszurichten – und somit sowohl Nachhaltigkeitsüberlegungen als auch systematische Veränderungsfähigkeit in Felder zu bringen, in denen diese bislang weniger präsent sind. Umgekehrt ist der Ansatz geeignet, um auf Wandel ausgerichtete Politikbereiche beziehungsweise Politiken widerstandsfähiger auszugestalten.
Resilienz als strategisches Leitkonzept
Nicht nur in der Ratgeberliteratur hat „Resilienz“ Hochkonjunktur – auch im politischen Bereich ist der Begriff zum allgegenwärtigen Schlagwort geworden. So nehmen Akteure auf allen Ebenen ihre Widerstandsfähigkeit in den Blick: Sie stellen die Frage, wie sie in schwierigen Zeiten ihre Handlungsfähigkeit bewahren, in Stresssituationen ihr Funktionieren aufrechterhalten oder sich von Krisen schnell erholen können. Es wird nach Lösungen für resiliente Lieferketten und Verkehrswege gesucht, Energienetze und IT-Infrastruktur werden nach Resilienzkriterien ausgestaltet, in smarten wie in analogen Städten werden Maßnahmenpläne zur Resilienzsteigerung entwickelt. Auch das Gesundheitswesen, die Weltwirtschaft, der Katastrophenschutz und sogar die Bundeswehr sollen resilienter werden. Dabei entwickelt sich der Begriff immer mehr zum strategischen Leitkonzept: Vereinte Nationen, Europäische Union, OECD und G7 nutzen es als Klammer für zahlreiche Rahmenwerke. Und jüngst hat die Bundesregierung unter Federführung des Innenministeriums eine Resilienzstrategie des Bundes vorgelegt.
Unser Erkenntnisinteresse
Wenn also Resilienz in Transformationskontexten immer präsenter, immer handlungsleitender wird, welche Auswirkungen hat dies auf die Ausgestaltung von Wandel? Welche Folgen hat die Konjunktur des Begriffs (und des dahinterstehenden Wunsches nach Widerstandsfähigkeit) für bestehende Gestaltungsziele – insbesondere für eine sozial-ökologische Transformation und das Leitbild der Nachhaltigkeit? Entstehen Zielkonflikte oder ergänzen sich die Konzepte? Diesen Fragen widmet sich die CO:DINA-Forschungslinie „Nachhaltige Digitalisierung durch transformative Resilienz“.
Resilienz als transformativer Hebel
Wir argumentieren, dass Resilienz-Ansätze zwar einerseits einen strategischen Fokus auf Bewahrendes und Systemerhalt zumindest nahelegen, aber dass im Konzept gleichzeitig auch Handlungsmöglichkeiten für tiefgreifenden Wandel angelegt sind. In der politischen Praxis versanden diese jedoch häufig; ein unterkomplexes und Status-quo-orientiertes Verständnis dominiert. Dies kann positive Gestaltungsziele (wie Nachhaltigkeit) unterlaufen. Dennoch ist es möglich, Resilienz als transformativen Hebel für eine nachhaltigere Politik nutzen: Der vorgeschlagene Ansatz der „transformativen Resilienz“ ermöglicht es, Resilienzpolitik an expliziten positiven Gestaltungszielen auszurichten – und somit sowohl Nachhaltigkeitsüberlegungen als auch systematische Veränderungsfähigkeit in Felder zu bringen, in denen diese bislang weniger präsent sind. Umgekehrt ist der Ansatz geeignet, um auf Wandel ausgerichtete Politikbereiche beziehungsweise Politiken widerstandsfähiger auszugestalten. Für die Gestaltung einer sozial-ökologisch ausgerichteten Digitalisierung ergeben sich entsprechend zahlreiche Forschungs- und Handlungsansätze.
Forschungslinienkoordinator
Mathias Großklaus
Dr. Mathias Großklaus ist seit August 2022 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsfeld Digitalisierung am IZT tätig. Seine Forschungsschwerpunkte sind gemeinwohlorientierte Digitalisierung, öffentliche Mobilität, ländliche Räume sowie Smart Cities und Smart Regions.